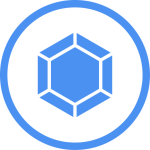Ein Teleskop ist ein optisches Instrument, mit dem du weit entfernte Objekte am Himmel genauer betrachten kannst. Es besteht aus einer Sammellinse oder einem Spiegel, der das einfallende Licht bündelt, und einem Okular, durch das du die vergrößerte Ansicht sehen kannst. Teleskope werden oft von Astronomen verwendet, um Sterne, Planeten und andere Himmelskörper zu beobachten. Mit einem Teleskop kannst du die Schönheit des Universums entdecken und mehr über die Geheimnisse des Himmels lernen.
a) Unsere Redaktion arbeitet unabhängig von Herstellern. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir ggf. eine Vergütung erhalten. Mehr erfahren. b) Wir verwenden Cookies, um den Traffic auf dieser Website zu analysieren. Durch die weitere Verwendung dieser Seite stimmen Sie dieser Nutzung zu. Datenschutzerklärung.